Immobilienwissen
Immobilien-Eigentum nach der Scheidung
Ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Niklas Clamann
Was passiert mit der gemeinsamen Immobilie bei einer Scheidung?
Wenn Ehen scheitern, stellt sich schnell die Frage: Was passiert mit der gemeinsamen Immobilie?
Für viele Paare ist das gemeinsame Haus oder die Eigentumswohnung der größte Vermögenswert und gleichzeitig auch die größte Verpflichtung.
Nicht selten wird die Immobilie zum zentralen Konfliktpunkt einer Trennung oder Scheidung. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche rechtlichen Regeln gelten und welche Möglichkeiten es gibt, mit der gemeinsamen Immobilie nach einer Trennung oder Scheidung umzugehen.

Gastautor Rechtsanwalt Niklas Clamann
Niklas Clamann betreibt eine auf das Familienrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei.
Im Rahmen der sogenannten Online Scheidung führt er seine Mandanten durch die einvernehmliche Scheidung.
Eigentum bleibt Eigentum – auch nach der Trennung
Wichtig ist zunächst: Die Eigentumsverhältnisse an einer Immobilie ändern sich durch eine Trennung oder Scheidung nicht automatisch.
Sind beide Partner im Grundbuch eingetragen, gehört die Immobilie weiterhin beiden, in der Regel zu gleichen Teilen. Auch wer wie viel zur Finanzierung beigetragen hat, spielt dabei zunächst keine Rolle.
Ebenso gilt: Ohne die Zustimmung beider Eigentümer kann keine Verfügung über die Immobilie getroffen werden. Weder ein Verkauf noch eine Vermietung oder Umnutzung ist einseitig möglich.
Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig zu einigen, wie mit der gemeinsamen Immobilie verfahren werden soll.
Was tun mit der Immobilie? Drei Optionen bei Einigung.
Wenn beide Partner noch miteinander kommunizieren können, bestehen grundsätzlich drei sinnvolle Optionen:
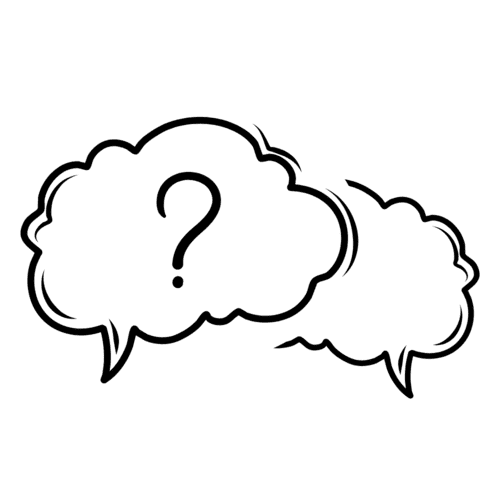
Verkauf der Immobilie:
Der einfachste Weg zur Vermögensauseinandersetzung ist der gemeinsame Verkauf. Der Erlös wird, je nach Eigentumsverhältnissen und weiteren Ansprüchen, aufgeteilt.
Ein professioneller Immobilienmakler kann helfen, den besten Verkaufspreis zu erzielen und den Verkaufsprozess objektiv zu begleiten.
Übernahme durch einen Partner:
Möchte einer der beiden die Immobilie behalten, kann er dem anderen dessen hälftigen Anteil auszahlen.
Grundlage für eine solche Regelung sollte eine neutrale Immobilienbewertung sein.
Wichtig: Auch die Übernahme der Kreditverbindlichkeiten muss mit der finanzierenden Bank abgestimmt werden.
Gemeinsame Vermietung:
In manchen Fällen entscheiden sich Ex-Partner dafür, die Immobilie zu vermieten und die Mieteinnahmen zu teilen.
Das erfordert allerdings ein gewisses Maß an Kooperationsbereitschaft und sollte vertraglich klar geregelt sein.
Keine Einigung? Teilungsversteigerung als letzter Ausweg!
Können sich die ehemaligen Partner nicht einigen, bleibt als rechtlicher Weg nur die Teilungsversteigerung. Dabei wird die Immobilie auf Antrag eines Miteigentümers durch das Amtsgericht versteigert, notfalls auch gegen den Willen des anderen.
Das Verfahren ist langwierig und häufig mit finanziellen Verlusten verbunden, da Immobilien bei der Teilungsversteigerung oft unter dem Verkehrswert verkauft werden.
Die Teilungsversteigerung sollte deshalb immer nur als letzte Lösung in Betracht gezogen werden.

Wer darf wohnen bleiben? Schutz der Ehewohnung und Wohnungszuweisung:
Auch wenn das Eigentum hälftig aufgeteilt ist, bedeutet das nicht automatisch, dass auch beide in der Immobilie bleiben dürfen.
Solange die Scheidung noch nicht vollzogen ist, gilt die gemeinsame Immobilie rechtlich als sogenannte „Ehewohnung“.
Diese steht unter besonderem Schutz!
Eine einseitige Räumung oder das „Hinauswerfen“ des anderen Ehepartners ist ohne weiteres nicht möglich. Kann keine Einigung über die Nutzung erzielt werden, kann beim Familiengericht eine Wohnungszuweisung beantragt werden.
Diese ist aber nur bei bestimmten Voraussetzungen erfolgreich, etwa bei Fällen von Gewalt, massivem Streit oder wenn Kinder geschützt werden müssen.
Nutzung durch einen Partner: Anspruch auf Nutzungsentschädigung
Zieht ein Ehegatte freiwillig aus und der andere nutzt die Immobilie allein, stellt sich die Frage nach einer finanziellen Kompensation. Denn der ausgezogene Partner hat in der Regel Anspruch auf Nutzungsentschädigung, da er seinen Anteil an der Immobilie nicht mehr nutzen kann.
Die Höhe der Nutzungsentschädigung orientiert sich am objektiven Wohnwert und kann entweder einvernehmlich geregelt oder im Streitfall auch gerichtlich durchgesetzt werden.
Was ist mein Wohnwert? Wir helfen unparteiisch weiter!
Lassen Sie Ihr Objekt unverbindlich bewerten. Ein Richtwert gibt Orientierung und nimmt Ihnen eine Sorge schon mal ab!
Gemeinsamer Kredit: Wer zahlt was – und wer haftet?
Viele Immobilien sind kreditfinanziert. Haben beide Ehepartner den Darlehensvertrag unterschrieben, haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Bank.
Das bedeutet: Die Bank kann frei wählen, von wem sie die Raten einfordert – auch dann, wenn ein Partner längst ausgezogen ist oder die Immobilie künftig allein genutzt wird.
Zahlt nur ein Ehegatte den Kredit weiter, kann er vom anderen einen internen Ausgleich verlangen. Er kann also vom anderen die Hälfte der allein gezahlten Raten zurückverlangen.
Es bietet sich an, dass der Ehegatte, der die Immobilie allein bewohnt, auch die Raten des Immobiliendarlehens allein zahlt.
Denn dann werden der Anspruch auf Nutzungsentschädigung einerseits und der Anspruch auf Rückzahlung der hälftigen Raten aus Gesamtschuldnerausgleich andererseits einfach miteinander verrechnet.

Niklas Clamann warnt:
Eine Entlassung aus dem Kreditvertrag ist nur mit Zustimmung der Bank möglich.
Meist verlangt diese dafür einen detaillierten Nachweis über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des verbleibenden Kreditnehmers.
Fazit: Frühzeitige Einigung erspart teuren Streit
Die gemeinsame Immobilie ist nach einer Trennung oder Scheidung oft eine der größten rechtlichen und emotionalen Herausforderungen.
Wer sich frühzeitig um Klarheit bemüht, ein Gutachten einholt und mit dem Ex-Partner eine einvernehmliche Lösung findet, erspart sich langwierige und kostspielige Auseinandersetzungen.
Ob Verkauf, Übernahme oder Vermietung:
Der richtige Weg hängt immer vom Einzelfall ab – und davon, wie gut die Kommunikation noch funktioniert. Wer sich beraten lässt und rechtzeitig handelt, schafft die Grundlage für einen sauberen Schnitt und einen geregelten Neuanfang.
Und am besten beraten sind Sie mit iNOVO
Wir sind da, von Anfang bis Ende
Objekte in Lörrach sorgenfrei verkaufen
Schnell, sicher, für einen guten Preis und ohne böse Überraschungen. Mit Empathie in jeder Lebensphase übernehmen wir den Verkauf Ihrer Immobilie.

Eine neue Wohnung kaufen
Ein Neustart, gerne auch mit neuem Eigenheim, neuer Region und frischem Wind. Bei Umzug in unsere Region oder einfach nur den Ort wechseln – wir sind da!
Weil wir Sie verstehen
Als Immobilienmaklerin: begleite ich immer wieder Paare, die sich im Zuge einer Trennung mit ihrer gemeinsamen Immobilie auseinandersetzen müssen.
Das ist emotional oft eine echte Zerreißprobe.
Umso wichtiger ist es, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten – auch wenn der gemeinsame Weg als Paar endet. Eine neutrale Wertermittlung schafft Klarheit und ist die Grundlage, um die wichtigsten Fragen zu klären:
- Kann oder will jemand bleiben?
- Ist eine Auszahlung möglich?
- Ist die gemeinsame Vermietung sinnvoll?
- Oder ist der Verkauf die bessere Lösung?
Ein Verkauf ist oft der letzte Schritt, aber wenn er ansteht, dann sollte er fair und professionell ablaufen.
Eine Zwangsversteigerung ist fast nie eine gute Idee – sie bringt meist Verluste und zusätzlichen Stress. Auch Privatkredite zur Auslösung sind selten sinnvoll.
Als Maklerin bin ich in solchen Fällen mehr als nur Vermittlerin.
Ich bin neutrale Ansprechpartnerin, Mediatorin zwischen den Parteien und bewahre einen kühlen Kopf, damit die Besichtigungen und der Verkauf professionell geregelt wird.

Jessica Gempp
Geschäftsführerin
Gerne helfen wir Ihnen weiter, fragen Sie einfach an!
Alles Wichtige nochmal zusammengefasst:
Wir begleiten unsere Kunden und Kundinnen oft durch schwere Phasen im Leben. Unsere Erfahrung und das Wissen von Niklas Clamann, beantwortet hier nochmal ein paar gängige Fragen.
Wenn ein Partner die Immobilie allein übernimmt, muss die Eigentumsänderung notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden.
Dafür bedarf es einer notariellen Urkunde, in der der aussteigende Partner auf seinen Miteigentumsanteil verzichtet und der verbleibende Partner als Alleineigentümer eingetragen wird.
Anschließend leitet der Notar den Antrag zur Grundbuchberichtigung beim Amtsgericht weiter. Die Kosten richten sich nach dem Geschäftswert und werden meist anteilig vereinbart.
Ein unabhängiges Gutachten schafft Klarheit über den Verkehrswert und dient als objektive Grundlage für Auszahlungen oder Kaufpreisverhandlungen.
Sachverständige prüfen Lage, Zustand, Bausubstanz und marktübliche Vergleichspreise. Die Gutachterkosten liegen je nach Region und Objekt zwischen 1 000 und 2 500 Euro, können aber oft als Teil der Scheidungskosten geltend gemacht werden.
Bevor Sie allein die Immobilie finanzieren, benötigen Sie die ausdrückliche Zustimmung der Bank zur Änderung des Darlehensvertrags.
Die Bank prüft dabei Ihre Bonität und kann neue Sicherheiten oder höhere Eigenkapitalanteile verlangen. Erst nach dieser Freigabe können Sie alleiniger Darlehensnehmer werden und Ihr Ex-Partner wird aus der Haftung entlassen.
Ohne Zustimmung bleibt die gesamtschuldnerische Haftung bestehen.
Bei der Übertragung eines Miteigentumsanteils fällt grundsätzlich keine Grunderwerbsteuer an, wenn beide Ehegatten im Grundbuch stehen und die Übernahme im Zuge der Scheidung erfolgt.
Anders verhält es sich bei Immobilienkäufen außerhalb des Familienrechts. Zudem kann bei Wiederverkauf innerhalb von zehn Jahren Spekulationssteuer anfallen.
Eine steuerliche Beratung lohnt sich, um Fristen und Freibeträge optimal zu nutzen.
Tragen Ex-Partner gemeinsam laufende Erhaltungsaufwendungen, obwohl nur einer die Immobilie nutzt, sollten diese Kosten im Rahmen der Nutzungsentschädigung verrechnet werden.
Bei Modernisierungen, die den Marktwert steigern, können Ausgaben anteilig berücksichtigt werden. Empfehlenswert ist eine klare schriftliche Vereinbarung, wer welche Investitionen trägt und wie spätere Erlöse oder Entschädigungen berechnet werden.
Ein eingetragenes Nießbrauchrecht sichert einer Partei lebenslang das Wohn- und Nutzungsrecht, während das wirtschaftliche Eigentum auf den anderen übergeht.
So kann ein Partner in der Wohnung bleiben, ohne volle Eigentümerlasten zu schultern, und der andere erhält eine anteilige Auszahlung.
Der Nießbrauch muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden; er endet erst mit dem Tod oder auflösenden Bedingungen im Vertrag.
Mediation bietet ein strukturiertes, außergerichtliches Verfahren, in dem ein neutraler Dritter beide Parteien zu einer tragfähigen Lösung führt. Im Vergleich zur Teilungsversteigerung ist sie zeit- und kostensparend und erhält die Gesprächsbasis.
Typische Mediationspunkte sind:
- Wertermittlung
- Nutzungsfragen
- Schuldentilgung
- und Verfahrensablauf
Ein positiver Nebeneffekt: Die erarbeitete Vereinbarung stärkt die Grundlage für eine spätere notarielle Beurkundung.





